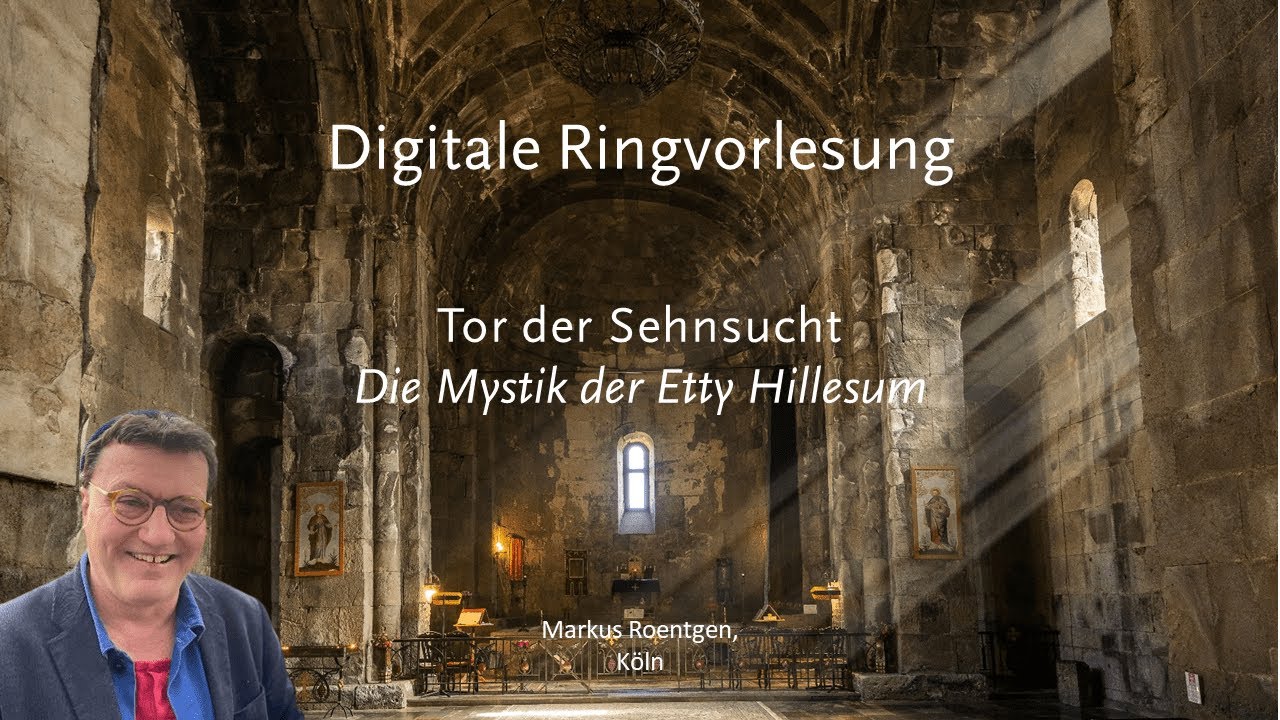Kurze Zusammenfassung
Dieser Text ist eine Betrachtung über das Leben und die spirituelle Entwicklung von Etty Hillesum, einer niederländischen Mystikerin des 20. Jahrhunderts, basierend auf ihren Tagebüchern und Briefen. Es werden die zentralen Themen ihrer Schriften beleuchtet, darunter ihre Gottverbundenheit, ihre Fähigkeit, inmitten von Leid und Verfolgung Sinn zu finden, und ihre Vision einer Welt, die auf Liebe und Güte basiert.
- Etty Hillesums Leben und Tod im Kontext des Holocaust.
- Die Entwicklung ihrer spirituellen und mystischen Einsichten durch ihr Tagebuch.
- Ihre Fähigkeit, inmitten von Leid und Verfolgung eine tiefe Gottverbundenheit und Liebe zu bewahren.
- Ihre Vision einer Welt, die auf Liebe, Güte und dem Respekt vor der Würde jedes Menschen basiert.
Einleitung: Etty Hillesum – Tor der Sehnsucht oder das denkende Herz der Baracke
Der Vortrag beginnt mit einem Zitat aus Etty Hillesums Tagebuch: "Ach, wir tragen ja alles mit uns, Gott und den Himmel, Hölle und Erde, Leben und Tod und Jahrhunderte." Zudem wird ein Vers aus dem Buch Jesaja (54,2) zitiert, der dazu auffordert, den Raum des eigenen Zeltes weit zu machen. Etty Hillesum, geboren 1914 und 1943 in Auschwitz-Birkenau ermordet, hinterließ ein Tagebuch, das als eines der eindrücklichsten spirituellen Zeugnisse des 20. Jahrhunderts gilt.
Ettys Leben und Hintergrund
Etty Hillesum wuchs in einer säkular jüdischen Familie in den Niederlanden auf. Ihr Vater war Lehrer für klassische Sprachen, ihre Mutter stammte aus Russland. Sie hatte zwei Brüder, einen Pianisten und einen Arzt. Nach dem Gymnasium studierte sie in Amsterdam Slawistik, Jura und Psychologie. 1941 begann sie eine Liebesbeziehung mit ihrem Therapeuten Julius Spier, der ihr riet, ein Tagebuch zu führen. Dieses Tagebuch dokumentiert ihre persönliche, seelische und spirituelle Entwicklung.
Ettys Beziehungen und spirituelle Entwicklung
Etty führte ein unkonventionelles Leben mit Beziehungen zu zwei älteren Männern, ihrem Hauswirt und Julius Spier. Trotz dieser Beziehungen und einer Abtreibung entwickelte sie eine tiefe Gottverbundenheit. Sie arbeitete 1942 beim Judenrat von Amsterdam, kündigte die Stelle aber, als sie erkannte, dass dieser die Verfolgung der Juden unterstützte. 1942 wurde sie ins Sammellager Westerbork deportiert, lehnte es aber ab, unterzutauchen, um solidarisch mit ihren jüdischen Leidensgenossen zu sein. 1943 wurde sie nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Die Veröffentlichung und Bedeutung von Ettys Tagebuch
Etty Hillesums Tagebuch wurde 1981 veröffentlicht und erlangte große Bedeutung. Es beginnt mit einer Erfahrung innerer Verschlossenheit und Lebensangst. Durch die Therapie bei Spier fand sie zum ersten Mal zum Wort Gott. Das Tagebuch dokumentiert ihre intensive Auseinandersetzung mit der Bibel, dem Talmud, dem Koran und Werken verschiedener Philosophen und Theologen. Ein erster Höhepunkt ihrer Gottvergegenwärtigung findet sich im Eintrag vom 26. August 1941, in dem sie von einem tiefen Brunnen in sich spricht, in dem Gott manchmal erreichbar ist.
Mystik und Alltagsleben
Etty Hillesum verband Mystik und Alltagsleben, indem sie aufmerksam für alle Dinge in sich und um sich herum war. Sie erkannte die Unfähigkeit der Menschen, einander wirklich zu begegnen, und betonte die Bedeutung der Liebe als Brücke zum Du. Sie setzte sich mit dem Kern der Heiligen Schrift auseinander und erkannte, dass Widerwillen gegen den Nächsten auf einen Widerwillen gegen sich selbst zurückzuführen ist. Sie nahm die Leiden ihrer Zeit wahr, die Verbrechen der deutschen Besatzung und die drohende Deportation, und ließ es an sich heran.
Selbstannahme und Gottannahme
Etty Hillesum erfuhr eine innere und äußere Bewegung, die der Annahme ihrer selbst entsprach. Selbstannahme und Gottannahme sind im letzten Grund eins. Sie ließ nichts aus, weder die Selbstwidersprüche noch das Leiden, die Schmerzen, die Zweifel, das Schöne und Gelingende. Sie erfuhr die Vereinigung der Gegensätze im größeren Einheitsgrund. Daraus erwuchs ihr die größte mögliche Hoffnung: "Ich gehe niemals und nirgends zu Grunde."
Etty Hillesum im Angesicht der Vernichtung
Im Jahr 1942, einem besonders schrecklichen Kriegsjahr, nahm Etty Hillesum die Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten in voller Bewusstheit wahr. Ihre Gottverbundenheit war alles andere als ein beschwichtigendes Verharmlosen des Geschehens. Sie breitete betend und um Sprache ringend das entstellte Leben im Tagebuch aus. Sie schloss sich nicht in ihrem Zimmer ein, sondern hielt die Augen offen und versuchte, die schlimmsten Verbrechen zu begreifen.
Die Poetik des Schweigens und der Sprache
Etty Hillesum suchte nach einer Sprache, die dem Schweigen entspringt. Sie glaubte, dass man auch im 20. Jahrhundert noch an Wunder glauben darf, und dass das Leiden die Würde des Menschen nicht antastet. Sie war jeden Tag in Polen auf den Schlachtfeldern, aber auch hier bei dem Jasmin und dem Stück Himmel vor ihrem Fenster. Sie nahm die neue Gewissheit hin, dass man ihre totale Vernichtung will, und arbeitete und lebte weiter mit derselben Überzeugung.
Das Mystische und die Einheit
Etty Hillesum fand einen Weg in die mystische Erfahrung, ins Abgründige, ins eine, ins ununterbrochene Du-Ich-Wir. Die mystische Erfahrung der Einheit wurde ihr zu einer Symphonie, in der alle Facetten ihres Lebens Ausdruck fanden. Sie vernahm, dass es zu dieser Zusammenschau der Räume und Zeiten innerer Einkehr bedarf. Sie sehnte sich nach Stille in der durchstoßten Außenwelt.
Die Umkehrung der Gottesbeziehung
Ab Mitte Juli 1942 vollzog sich bei Etty Hillesum eine Umkehrung in ihrer Gottesbeziehung von der gottbedürftigen zur gotthelfenden. Sie erkannte die Bedürftigkeit Gottes zur Welt hin, die Armut Gottes in der Welt, die Gewaltlosigkeit und Ohnmacht des Göttlichen. Sie verknüpfte jüdische und christliche Motive aus ihrer Erfahrung in der geschichtlichen Stunde des äußersten Ausnahmezustandes von Leben. "Und wenn Gott mir nicht weiterhilft, dann muss ich Gott helfen."
Das denkende Herz der Baracke
Etty Hillesum nannte sich das denkende Herz der Baracke, tief Gott verbunden in der solidarischen Nähe des Nächsten. Sie ruhte in sich selbst und nannte das Allertiefste und Allerreichste in sich, in dem sie ruhte, Gott. Sie horchte in sich und andere hinein und forschte nach den Zusammenhängen in diesem Leben und nach Gott. Sie hatte kein Heimweh mehr, sie war zu Hause.
Die letzten Briefe aus Westerbork
Aus dem Lager Westerbork schrieb Etty Hillesum noch einige Briefe. Auch hier war sie im unbeschreiblichen Elend ungebrochen im Kern. Die zerstörerische Willkürherrschaft der Nazis konnte ihr den ewigen Gottkern nicht rauben. Sie wurde in allem unfasslichen Leiden als fröhlich, hilfsbereit und tatkräftig geschildert. In einem ihrer letzten Briefe schrieb sie: "Das Leben ist etwas herrliches und großes. Wir müssen später eine ganz neue Welt aufbauen und jedem weiteren Verbrechen, jeder weiteren Grausamkeit müssen wir ein weiteres Stückchen Liebe und Güte gegenüberstellen."